Wie verwirrt man Engel?
27.11.2023
auch wenn sie sich über Träume reinzuschleichen trachten?
Indem man bei sich bleibt, also auch generierte Träume komisch findet und fehlklangig.
Wie verwirrt man Daemonen oder schüttelt sie ab?
…. spannenderweise genauso.
<.
Man hat zwei Möglichkeiten: entweder immer diesen Halbseidenen nachflattern, aus den eigenen Vollendet (- was hier Vollendungs- also werdend-zukunfend-od-lieddend. wehend atmend.. wird) strukturen,
oder bei sich bleiben, wie ein herrlicher Baum, ein Berg, eine Landschaft..
und die Flatterer zwitschern und grunzen lassen.
Be-_–einträchtigte
kurzer Sprung in Wortwebetreue
Eintracht · einträchtig · einträchtiglich · Einträchtigkeit · Zwietracht · zwieträchtig
Eintracht f. ‘Übereinstimmung (im Denken und in der Gesinnung), Einmütigkeit, Einigkeit, Verträglichkeit’. Im 14. Jh. in der Rechtssprache auftretendes mnd. ēndracht und mhd. (nur md.) eintraht ‘Übereinkunft, Absprache, Vertrag’ ist abgeleitet von mnd. (over)ēndrāgen, (over)ēndrēgen, älter över ēn, in ēn drāgen (mhd. über ein tragen) ‘übereinkommen, -stimmen, sich vertragen, beschließen, vereinbaren’; vgl. frühnhd. übereintragen, nl. overeendragen; s. ein1 Num. und tragen, Tracht. Eintracht dringt erst im 16./17. Jh. (wesentlich später als einträchtig und Einträchtigkeit, s. unten) vom nd.-md. Sprachgebiet ins Obd. vor. – einträchtig Adj. ‘einmütig, friedlich’, mnd. ēndrachtich, ēndrechtich, mhd. (nur md.) eintrehtec (13. Jh.), seit dem 15. Jh. auch obd.; etwa gleich alt ist die Bildung mit Doppelsuffix einträchtiglich Adv. mnd. ēndrachtichlīk, spätmhd. eintrehteclīche. Einträchtigkeit f. mnd. ēndrachtichēt, ēndrechtichēt, mhd. eintrehtecheit (14. Jh.), im 15. Jh. ins Obd. vordringend. Zwietracht f. ‘Uneinigkeit, Zwist’, mnd. twēdracht, twīdracht, mhd. zwitraht (um 1300), abgeleitet von mnd. twēdrāgen, twēdrēgen, entwey drāgen, drēgen, mhd. enzweitragen ‘uneins sein, sich entzweien’; wie Eintracht vom Nd.-Md. ausgehend, jedoch früher auf das Obd. übergreifend. Geläufig in der Verbindung Zwietracht säen ‘Unfrieden stiften’, die lat. discordiās serere folgt. zwieträchtig Adj. ‘uneinig’, mnd. twēdrachtich, mhd. zwitrehtic (14. Jh.). Die ganze Wortgruppe wird vom heutigen Sprachgefühl aus zu trachten (s. d.) gestellt.
trachten Vb. ‘bestrebt sein, beabsichtigen, etw. Bestimmtes zu erreichen, zu erlangen suchen’, ahd. trahtōn (8. Jh.), trahten (9. Jh.), mhd. trahten ‘betrachten, woran denken, worüber nachdenken, worauf achten, erwägen, überlegen, bedenken, nach etw. streben’, asächs. gitrahton, mnd. trachten ‘betrachten, bedenken’, mnl. nl. trachten ‘streben, suchen, versuchen’, aengl. trahtian ‘erklären, erörtern, betrachten’ sind entlehnt aus lat. tractāre ‘behandeln, betreiben, sich mit etw. beschäftigen, bearbeiten, untersuchen, überdenken’, eigentlich ‘(herum)schleppen, -ziehen’, einem Intensivum zu lat. trahere (tractum) ‘ziehen, schleppen’. S. hierzu Traktat.
Menschen
(wie diese ganzen verschnallten Muskelpakete, unansprechbare Gläubige, in Kreisen kreisende Sekundär“wurzelnde“, sonstige Hirnkinoweltendauergebärende und andere Menschenwesen, mit denen diese Halbseidenen so gerne spielen.. und solche Mensche mit solchen Entitäten, da sie ihnen Kräfte und Mächte vorludern, die solchen Menschen eben als InIhnenKino gefallen)
leben das laufende Verzerrtwerden durch andere Anderwesen, Mitwesen und GES.chehen und Geschehen. Sie SIND also klarerweise Eigenraumwesen, nur erleben sie nicht durch ihren wahren Gesamtwesensraum, sondern als DurcHHaus von etlichem oder allem..
Sie haben die Eigenklanglichkeit und Eigenerklingung noch nicht als Gegen=Mitspiel = Ant-W-Ort.
Sie gewahren – also ihre Bewußt-Mitgeschehensarbeit geschieht erst — flach, zweidimensional, plakativ. Und sie nützen letztlich Schlieren, um erste Raumahnung zu „erleben“. Na und an Schlieren und Halbgeschehensfragmenten fehlt’s uns ja nicht <<.
Wäre das notwendig?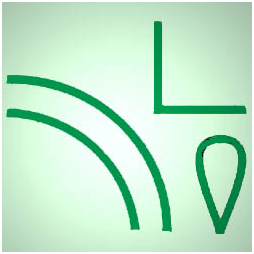
Nein.
Sprechen wir einmal über „Verstehen“.
stehen ___https://www.dwds.de/wb/etymwb/stehen___ ist hier das schöne Grundingrediens. Und wenn wir die Menschengruppen fühlen wollen, die sich da in Landschaften, die wir heute auch kennen, durch ihre Leben wahres Lauten, Worten mitzuGest’alten ehrlich mühten..wertschätzen wollen, dann freuen wir uns über die Wortwebebespielungskräfte und -meisterlichkeit, die JEDER VON UNS einfach so.. in die Wiege als Teil des Ergbutes gelegt bekommen hat, und darin sich frei mitbewegen darf, eventuell Dichter, Gutwortmeister in allen Handlungsbranchen oder Wahrwortender im eigenen Wesensgesamtraum (und das ausstrahlend, also anklingend wahr in anderer Wahr: sehr schenkend! Muß man sich allerdings auch schenken lassen <<<. ) werdend, den eigenen Wortgewebezugang wunderbar und zuchtvoll geölbend, tragend, spannend, darlegend und darbietend auch… erleben lassend, aus erlebend.
stehen Vb. ‘auf die Füße gestellt sein, auf einer Stelle verharren’ geht zurück auf ahd. (8. Jh.), mhd. stēn, woraus (bei Überführung in die regelmäßige Konjugation mit zur Silbentrennung und wohl auch als Dehnungszeichen nach dem Muster von ↗︎sehen, s. d., eingefügtem h) stehen (zuerst md. 14. Jh.) wird. Ahd. mhd. stēn ist eine (wohl unter dem Einfluß von ahd. mhd. gēn neben gān, s. gehen, entstandene) Nebenform zu ahd. (8. Jh.), mhd. asächs. mnd. stān, mnl. staen, nl. staan, schwed. stå. Daneben besteht ein nasalierter und Dentalerweiterung aufweisender Stamm germ. *stand- in ahd. stantan (8. Jh.), mhd. standen, asächs. standan, mnl. standen, afries. stonda, aengl. standan, engl. to stand, anord. standa, got. standan (wozu auch ↗︎Stand und mit sekundärem Ablaut ↗︎Stunde, s. d., gehören). Wie Präteritalformen ohne n (got. stōþ, stōþum, aengl. stōd, stōdon, engl. stood ‘stand, standen’) zeigen, war der Nasal in germ. *stand- ursprünglich nur präsensbildend. Verwandt sind aind. sthā- ‘stehen’, tíṣṭhati ‘steht’, griech. histánai, Aorist stḗnai (ἱστάναι, στῆναι) ‘stellen’, lat. stāre ‘stehen’, air. tair(ṡ)issiur ‘stehe, bleibe stehen’, lit. stóti ‘sich (hin)stellen, treten’, aslaw. stojati, russ. stoját’ (стоять) ‘stehen’, aslaw. stati ‘sich stellen’, russ. stat’ (стать) ‘werden, anfangen, sich stellen’. Man vereinigt alle Formen unter einem Wurzelansatz ie. *stā, *stə- ‘stehen, stellen’ und betrachtet die aspirierte Tenuis (th) des Aind. als Neuerung gegenüber der ie. Ausgangsform. Das ā in den Kurzformen des germ. Verbs (statt eines lautgesetzlich zu erwartenden germ. ō) geht auf eine frühe Angleichung an das unter ↗︎gehen (s. d.) behandelte, zur Wurzel ie. *g̑hē-, *g̑hēi- gehörende Gegenwort zurück (vgl. ahd. mhd. gān, s. oben). An die Wurzel ie. *stā- bzw. deren unterschiedliche Erweiterungen schließen sich eine Vielzahl von Wörtern an (s. z. B. ↗︎Stadel, ↗︎Stadt, ↗︎Statt, ↗︎Staude, ↗︎stauen, ↗︎staunen, ↗︎stet, ↗︎Steuer1 f. ↗︎Steuer2 n., ↗︎stieren, ↗︎Stuhl, ↗︎stur, ↗︎Stute, ↗︎stützen). gestanden Part. adj. ‘erfahren, gesetzt’ (ein gestandener Mann), spätmhd. gestanden ‘groß, erwachsen’, also wohl ‘zum Stehen gekommen’. abstehen Vb. ‘von etw. ablassen, abgehen, von etw. entfernt sein’, seit dem 16. Jh. auch ‘durch langes Stehen an Qualität verlieren, verderben’, mhd. abestān, abestēn, auch ‘absteigen’ (vom Pferd); Abstand m. ‘Distanz, Entfernung’ (17. Jh.), ‘das Ablassen, Aufgeben von etw.’ (15. Jh.), Abstand nehmen von etw. ‘auf etw. verzichten’ (19. Jh.). auferstehen Vb. ‘vom Tode wieder erstehen’, ahd. ūfirstantan, -stān, -stēn (9. Jh.), mhd. ūferstān ‘aufstehen, sich erheben, vom Tode auferstehen’; Auferstehung f. ‘Wiedererwecktwerden vom Tode’ (15. Jh.); vgl. mhd. ūferstandunge. aufstehen Vb. ‘sich erheben’, ahd. ūfstantan, -stān, -stēn (9. Jh.), mhd. ūfstān, auch ‘jmdm. aufkündigen, aus dem Dienst treten’; Aufstand m. ‘Erhebung, Empörung, Aufruhr’, spätmhd. ūfstant; aufständisch Adj. ‘aufrührerisch, sich erhebend, empörend’ (19. Jh.). ausstehen Vb. ‘fällig, zu zahlen sein’ (14. Jh.), ‘weggehen, seinen Dienst verlassen, eine Verpflichtung erfüllen’ (15. Jh.), ‘etw. bis zum Ende durchstehen, ertragen, aushalten’ (16. Jh.), mhd. ūʒstān, -stēn ‘aus-, wegbleiben, ausruhen (vom Pferd)’; Ausstand m. ‘Arbeitsniederlegung, Streik’; seit dem 17. Jh. im Obd. (zunächst im Bair.) in der speziellen Bedeutung ‘Ausscheiden aus einem Dienst, einer Stellung’ (Gegensatz Einstand, s. unten); seit den 80er Jahren des 19. Jhs. auf Arbeitsniederlegungen bezogen; in dieser Bedeutung seit etwa 1890 allgemein verbreitet neben dem aus dem Engl. entlehnten Konkurrenzwort ↗︎Streik (s. d.). Außenstände Plur. ‘fälliges, noch nicht (zurück)gezahltes Geld’ (19. Jh.); älter Ausstände Plur., Ausstand m., mhd. ūʒstant ‘ausstehendes Geld’. beistehen Vb. ‘unterstützen, helfen’, ahd. bīstantan, -stān, -stēn (9. Jh.), mhd. bīstān ‘dabeistehen, Hilfe leisten’; Beistand m. ‘Hilfe, Unterstützung’, spätmhd. bīstant. bestehen Vb. ‘(auf längere Zeit) existieren, vorhanden sein, erfolgreich zum Ende führen’, ahd. bistantan, -stān, -stēn ‘bleiben, verharren’ (9. Jh.), mhd. bestān, bestēn ‘stehenbleiben, standhalten, umstehen, entgegentreten, feindlich angreifen, etw. unternehmen’; Bestand m. ‘Dauer, Existenz, Vorrat’, frühnhd. bestant (Anfang 15. Jh.), auch ‘Waffenstillstand, Pacht’; vgl. ahd. bistentida f. (10. Jh.); beständig Adj. ‘dauerhaft, immer wiederkehrend, festbleibend’, mhd. bestendec; Bestandteil m. ‘Teil eines Ganzen, einer größeren Einheit’ (18. Jh.). einstehen Vb. ‘für etw. eintreten, bürgen, etw. verantworten’ (18. Jh.), frühnhd. ‘in eine Gemeinschaft eintreten, einen Dienst antreten’, spätmhd. īnstān (substantiviert) ‘das In-sich-selbst-Sein’; Einstand m. ‘Amts-, Dienstantritt, Eintrittsleistung, -geld, Eintrittsschmaus’, spätmhd. īnstant ‘Vorkaufsrecht, Einstellung der Gerichtsverhandlung’. entstehen Vb. ‘sich entwickeln, hervorgehen’, ahd. intstantan, -stān, -stēn ‘verstehen’ (8. Jh.), mhd. entstān, -stēn ‘verstehen, wahrnehmen, merken’, vom Mhd. an auch (gemäß den unterschiedlichen Verwendungen von ↗︎ent-, s. d.) ‘sich von etw. wegstellen, entgehen, mangeln’ (so bis ins 19. Jh.) und ‘zu sein beginnen, werden’. gestehen Vb. ‘bekennen, nicht leugnen’, ahd. gistantan, -stān, -stēn ‘(be)stehen, fest-, stillstehen, beruhen, aufhören, anfangen, standhalten’ (9. Jh.), mhd. gestān, -stēn, auch ‘sich stellen, treten, beistehen, zugestehen, wozu stehen, bekennen (vor Gericht), kosten’; eingestehen Vb. ‘bekennen’ (18. Jh.); zugestehen Vb. ‘gewähren, einräumen’ (17. Jh.); vgl. mhd. zuogestēn ‘mit jmdm. einmütig sein, zur Seite stehen’; geständig Adj. ‘seine Schuld bekennend’ (16. Jh.), mhd. gestendec ‘beständig, unveränderlich, einwilligend, zustimmend, hilfreich’; Geständnis n. ‘Bekenntnis der Schuld, das Eingestehen’ und ‘das Eingestandene’ (17. Jh.). Umstand m. ‘besondere Lage, Sachverhalt’ (15. Jh.), in (gesegneten, anderen) Umständen sein ‘schwanger sein’ (17. Jh.), ‘Umschweif, Umständlichkeit’ (15. Jh.), (keine) Umstände (‘Umständlichkeiten’) machen (16. Jh.), ‘(keine) Mühe, Förmlichkeit machen’ (18. Jh.); vgl. mhd. umbestant ‘was, wer herumsteht’ (kollektiver Sing.). unterstehen1 Vb. ‘unter einem Schutzdach stehen, sich unterstellen’, spätmhd. understān, -stēn; Unterstand m. ‘Unterkunft, wo man sich unterstellt, Schutz’ (16. Jh.), militärisch ‘abgedeckter Schutzraum’ (19. Jh.), spätmhd. understant ‘Stütze, Hilfe’. unterstehen2 Vb. ‘untergeordnet, unterstellt sein’ (17. Jh.), reflexiv ‘wagen, sich erlauben, erdreisten’ (16. Jh.), ahd. untarstantan, -stān, -stēn ‘haltmachen, zukommen’ (8. Jh.), mhd. understān, -stēn ‘zustande bringen, bewirken, bestehen, bekämpfen’, reflexiv ‘etw. unternehmen, sich einer Sache unterziehen’.↗︎ verstehen s. d. vorstehen Vb. ‘hervorragen, an der Spitze stehen, leiten’, ahd. forastantan, -stān, -stēn ‘voranstehen, sich auszeichnen, vorhanden sein’ (9. Jh.), mhd. vorestān, -stēn ‘bevorstehen, sorgen für, regieren’; Vorsteher m. ‘Leiter’ (16. Jh.); Vorstand m. ‘Leitungsgremium, Leiter’ (Anfang 19. Jh.), älter ‘Verteidiger, Bürge’ (15. Jh.), ursprünglich auch ‘Zustand des Stehens vor einem anderen oder etw. anderem, Bürgschaft, erste Stelle’ (16. Jh.). Widerstand, widerstehen s. ↗︎wider. zustehen Vb. ‘von Rechts wegen gebühren, Anspruch auf etw. haben’ (15. Jh.), mhd. zuostān, -stēn ‘verschlossen sein, zu einem treten, ihm beistehen, zukommen, angehören, zuständig sein’; Zustand m. ‘Art und Weise, Verhältnisse, worin sich Personen und Dinge befinden’ (17. Jh.), älter ‘Hinzugehöriges, Dabeistehendes’ (15. Jh.); zuständig Adj. ‘zur Sache gehörig, kompetent’, auch ‘dazugehörig’ (16. Jh.), ‘zeitlich bevorstehend’ (17. Jh.).
____
_______
Jeden Wesen seine Selbstliebe-/Selbstverständnis-/Zukunftende Hülle lassen,
__was IMMER richtig ist, denn der Alleinklang sind wir nicht, wir sind Teil, Feinung, Einzelung.. UND RAUMSPRUCH ist das Werdenehmen, das Inswerdennehmen aller Wesen und Wesensreste. Es steht uns also nicht zu, diese Aufgabe des Werdeströmens uns anzumaßen. Vor Ort allerdings.. haben wir die Zuständigkeit sehr wohl, Fug und Werdung raumzuwahren, mit. Also solcher Wesensreste eigentlich.. „Wesen“ Unfug und Sichbrecherischumtun Ein(viele liele <<.)halt ALTZUGEBIETEN.. bis die abschnorfeln, und aus Para-Siten wieder Echtseiende zu werden vorziehen. Weil sie mit parasitieren
Parasit · parasitär · parasitisch
Parasit m. ‘Schmarotzer, wer von der Arbeit oder auf Kosten anderer lebt’, dann (in der Biologie) tierisches oder pflanzliches Lebewesen, das in oder auf anderen Organismen lebt. Lat. parasītus, griech. parásītos (παράσιτος) ‘Tischgenosse, Gast, Schmarotzer’, eigentlich ‘wer seine Speise bei einem anderen hat’, vgl. griech. sī́tos (σῖτος) ‘Weizen, Getreide, Speise, Nahrung’ und s. para-; griech. parásītos bezeichnet in der Komödie einen Possenreißer, der für ein Essen die Gäste auf Kosten der eigenen Person unterhält und erheitert. Das Substantiv begegnet, an das antike Vorbild gebunden, in griech. und lat. Form seit dem 16. Jh. in dt. Texten; eingedeutschtes Parasit (Plur. Parasiten) tritt im 18. Jh. auf, fachsprachliche Anwendung mit der heute im Vordergrund stehenden Bedeutung ‘Schmarotzerpflanze, -tier’ im 19. Jh. – parasitär Adj. ‘schmarotzerhaft, durch Parasiten hervorgebracht’ (20. Jh.), nach frz. parasitaire; älter parasitisch Adj. (18. Jh.).
schmarotzen · Schmarotzer
schmarotzen Vb. ‘auf Kosten anderer leben’ (16. Jh.), älter smorotzen, schmorutzen, schmorotzen ‘betteln’ (15. Jh.). Die Herkunft ist ungeklärt. Anschluß ans Rotw. ist nicht nachzuweisen. Zugehörigkeit zu dem Verbtyp auf ahd. -azzen, mhd. -ezen (s.↗︎ ächzen, ↗︎blitzen, ↗︎schmatzen), landschaftlich -o(t)zen (vgl. frühnhd. glockotzen ‘rülpsen’) ist möglich. Best in: Studia Neophilologica 62 (1970) 451 ff. erwägt Kontamination aus ↗︎schnorren ‘betteln’ (s. d.) und spätmhd. mutzen ‘abschneiden, stutzen’ (14. Jh.). – Schmarotzer m. ‘wer auf Kosten anderer lebt, Parasit’ (16. Jh.), Smorotzer ‘Bettler’ (15. Jh.), Schmorotzer ‘Knauser’ (16. Jh.). Seit etwa 1800 werden Verb und Nomen agentis auch in der Naturwissenschaft für ‘parasitieren’ bzw. ‘Parasit’ gebraucht.
Letztlich: dich nähren, entziehen dem Raum und dessen Wesen und Reichen.. für DEM RAUM NICHT sich gegenneigende Bezweckungen. Werdegeschehen und WErdekräfte absaugen, und „umwidmen“. Parasitenoptimal: UM DIESE RAUM ZU ZERSTÖREN dann auch noch.. Hittn.Hittla eben.. wollen in Palästen, herrlichstem Stoff und Handwerk und Gerierung prallsuhlen.. und ihre Hirne nicht und nichts in ihnen.. brächte je ein Keimblatterl Dank dafür nicht mal aus dem Arsch. Die mit dem Arsche fressen //und entsprechenden „Hirn=KOMM AN DOsteuerungen“ klaro haaam////.. Lebendgeschehen, Lebenszeit aus allem. Man darf.. jene dem freien Raumströmen überantworten. DE WERDEESSENZBESTIMMUNGS(zu)spruch, der auch ein völliges ZerfALLenLASSEN sein kann.. WAHRWAHR.. Raum kann’s. Und wir haben das nicht auf gelogenauch allenthalben zu veregopinkeln. chi non pisca in compagnia… naaaa Punkt.
Sich an allem zu schaffen machen/geben? Ok.. nun aber wieder ein kurzes SEI WAS DU B’IST! Und dann rennst und entfleucht, was das über Haupt noch kann.. der Vollparasit ist nicht mehr flucht-entfernungsfähig. Tja… man hat sich’s ausgesucht, und es ja auch genossen: mit Genossen überdies, so steht anständig zu vermuten, ja.
schnorrenVb. ‘(er)betteln’, auch schnurren (18. Jh.), aus der Gaunersprache. Den Hintergrund bildet ein alter Brauch, mit der Schnurrpfeife als Bettelmusikant herumzuziehen________na? DA haben sich unsere Massenhaftmedien(fritzenfransenzottelnvorauseilend.a.gführigen und so pufffort) ja doch wahrlich nette Hittn zsamgschnurrt.. last Schnurre? Wissen wir alle, SOLLTE UNS JA und sitzt uns in den Knochen. aber irgendwann lernen auch wir!! _______________________; s. schnurren, Schnurre. – Schnorrer m.‘Bettler, Landstreicher, Schmarotzer’ (18. Jh.).
einfach abschnattern, an was sie anzufallen begehrlich hirnrußen.
sehr wohl aber das eigenen Umraumverstehen wahr und klar, in sich nüchtern, wahr-steuern/bi=> bei(!!) t ragen;
also nicht im Werdegewebeverbiegen eines stark ichigen oder nichtigem in Wahrheit (die geanzen HIVE MINDS, die allesamt verlorene Würschtln sind, da sie im nicht verstehenden Vergehen, Zersetzen, Zerfallen Vermorschen hirnwohnen, ALSO IHRES FÜHLVERSTEHEN und Fühlstand.. längst so oder so.. verlustig gegangen sind, und nun nur mehr blubberbrodeln in ihren dahinsegelnden, glosenden Hirnpfannen..
also b-lassen ja, deren Fehleinbindung in alles Werdegeschehen aber schlicht ihnen EBENFALLS lassen.. wer baumeln will, soll baumeln. Denn sonst behutschen die nur alles mit hrem glosenden Restwahn. Und zerstörene elendiglich so viel Echtgutes. (….weiter noch…)
__________
___________
ICH WILL GUT DASTEHEN, ABER NICHT GUT HANDELN.
WAS BRINGT MIR DAS??
s p a n n e n d
___________

übel, …
übel Adj. ‘körperlich unwohl, moralisch schlecht, unerfreulich, unheilvoll’,
ahd. ubil (8. Jh.),
mhd. übel, (
md.)
ubel,
asächs. uƀil,
mnd. ovel,
mnl. evel,
ovel,
oevel,
nl. euvel,
aengl. yfel,
engl. evil,
got. ubils setzen
germ. *uƀila- voraus, eine Bildung mit dem Bindevokal aufweisenden Suffix
germ. -ila- (entwickelt aus
ie. -lo-).
Außergerm. vergleicht sich allein
mir. fel ‘schlecht’, so daß
ie. *upelo- ansetzbar ist. Nimmt man als Grundbedeutung ‘über das normale Maß hinausgehend’ (vgl.
ahd. ubbi ‘böse handelnd’) an, ist Anschluß an die Präposition
ie. *upo,
*up,
*eup ‘unten an etw. heran’, dann ‘(von unten) hinauf, über’ (s.
auf,
ob1,
über) möglich. Vgl.
wohl oder übel ‘gut oder schlecht’ (16. Jh.), formelhaft ‘notgedrungen, ob man will oder nicht’ (19. Jh.). –
Übel n. ‘Mißstand, langwierige (schwere) Krankheit, das Böse’,
ahd. ubil (8. Jh.),
mhd. übel, Substantivierung des Adjektivs. Daneben in älterer Sprache eine fem. Ableitung
ahd. ubilī (9. Jh.),
mhd. übele.
Übelkeit f. ‘mit Brechreiz, Schwindel verbundenes körperliches Unwohlsein’ (18. Jh.).
Übeltat f. ‘böse, verwerfliche Tat, Verbrechen’,
ahd. ubiltāt (9. Jh.),
mhd. übeltāt, vielleicht Wiedergabe von
lat. maleficium; dazu
Übeltäter m. mhd. übeltæter; vgl.
ahd. ubiltāto.
hinterhältig, … 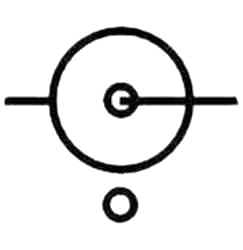
hinter2 Präp. mit Dativ und Akkusativ ‘an der, an die Rückseite von’, ein konstantes Lageverhältnis (bei Ruhe und gleichlaufender Bewegung) oder die Richtung auf einen Zielpunkt angebend, von räumlichen Vorstellungen her auch auf zeitliche Verhältnisse übertragen (vgl.
etw. hinter sich haben,
bringen);
ahd. hintar (10. Jh., bereits für das 9. Jh. mehrfach als 1. Kompositionsglied bezeugt, ferner in
hintarort ‘zurück, verkehrt’,
gihintaren,
firhintaren, s.
hindern,
verhindern),
mhd. hinder,
frühnhd. hinder,
hinter,
mnd. hinder (auch temporal ‘nach, von … an’),
mnl. hinder,
got. hindar (auch ‘jenseits von’). Die heute literatursprachlich allein in präpositionaler Verwendung übliche Lokalpartikel ist zunächst Adverb, daher noch
mhd. mnl. aengl. hinder ‘hinten, nach hinten, zurück’ (
aengl. auch ‘hinunter’) sowie die oben angeführten Ableitungen und zahlreiche Zusammensetzungen im
Ahd.; nur die regionale Umgangssprache bewahrt Reste des adverbiellen Gebrauchs in Präfixverben wie
omd. südd. hinterbringen,
-kommen,
-schaffen (‘nach hinten’),
omd.hinteressen,
-kippen,
-schlucken (‘hinunter’); vgl. auch
dahinter. Bei
hinter, das wahrscheinlich an den unter
hinten (s. d.) genannten erweiterten Pronominalstamm
germ. *hind- anzuschließen ist, handelt es sich um eine Adverbialbildung auf -r, vergleichbar den in
da1,
hier,
wo (s. d.) fortlebenden Pronominaladverbien
ahd. thār,
hier,
(h)wār und anderen lokalen Adverbien und Präpositionen mit derselben Endung, z. B.
außer,
nieder,
über,
unter (s. d.). Dieser Bildungstyp liegt vielleicht alten Komparativformen auf
ie. -(t)ero- zugrunde (s.
hinter1 Adj.). –
hinterher Adv. räumlich ‘nach einer Person, Sache folgend’, auch (in der Gegenwart häufiger) zeitlich ‘danach, später’ (Anfang 18. Jh.), entstanden aus adverbialen Bestimmungen des Typs
hinter jmdm., etw. her durch verkürzende Zusammenrückung von Präposition und nachgestelltem Adverb (s.
her).
hinterrücks Adv. ‘von hinten’, daher ‘unversehens, heimlich, heimtückisch’ (15. Jh.,
frühnhd. hinderrucks,
-rücks), gelegentlich im Sinne von ‘rücklings, mit dem Rücken voran’; Verschmelzung von
mhd. frühnhd. hinder Präp., das in älterer Zeit vereinzelt auch den Genitiv regiert, mit der Genitivform des (ehemals stark flektierenden) Substantivs
mhd. frühnhd. rück(e),
ruck(e) (s.
Rücken); vgl. vorausgehendes
ahd. hintarruggi (10. Jh.),
mhd. hinderrucke ‘rückwärts, zurück’ (aus Präposition und Akkusativform).
Hinterhalt m. ‘Versteck, von dem aus man einem Gegner auflauert, ihn überraschend (eigentlich von hinten) angreift, Falle’ (16. Jh.), früher auch ‘Truppenreserve, Stütze, Rückhalt’ (so schon 15. Jh.), ‘heimlicher Vorbehalt’ (17. Jh.); dazu
hinterhältig Adj. ‘seine wahren Absichten verbergend, verschlossen, heimtückisch’ (17. Jh.; bis ins 19. Jh. oft
hinterhaltig); nicht verwandt ist
frühnhd. hynderheldig ‘abschüssig’, 15. Jh. (zu
Halde, s. d.).
Hinterlist f. ‘heimtückisches Wesen, unehrliches Handeln, Falschheit’,
mhd. hinderlist m. (zum Grundwort s.
List); dazu älter bezeugtes
hinterlistig Adj. ‘heimtückisch, unaufrichtig’,
ahd.hintarlistīg (Hs. 12. Jh.),
mhd. hinderlistec.
Hinterland n. ‘wirtschaftlich nutzbares Gebiet in der Umgebung einer Stadt, eines Hafens, Industriezentrums’, vom 15. Jh. an vereinzelt belegt, im letzten Viertel des 19. Jhs. geläufig, zu dieser Zeit vor allem Rechtsbegriff der Kolonialpolitik (vgl. die Entlehnungen
engl. frz. ital. span. hinterland), seit den 20er Jahren des 20. Jhs. auch ‘Gebiet hinter der Front’.
Hintersasse m. ‘von einem Feudalherrn abhängiger Bauer’ (eigentlich ‘wer hinter einem, in dessen Schutz ansässig ist’), auch ‘Stadtbewohner ohne Bürgerrechte, Zugezogener’ (seit dem 14. Jh. allgemeiner ‘zur Miete Wohnender’),
mhd. hindersæʒe,
hinderseʒʒe; im
Nhd. setzt sich eine umlautlose Nebenform durch (zur Bildungsweise s.
Insasse).
Hinterwäldler m.‘ungeschliffener, urwüchsig derber, weltfremder Mensch’, heute meist spöttisch für einen hinter der modernen Entwicklung Zurückgebliebenen; Lehnbildung (30er Jahre des 19. Jhs.) nach
amerik.-engl. backwoodsman, das zunächst den Ansiedler im Westen Nordamerikas jenseits des Alleghanygebirges bezeichnet.
gut, … 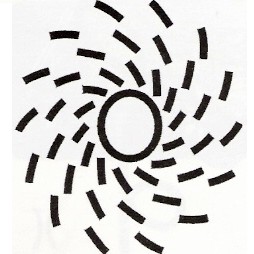
gut Adj. ahd. (8. Jh.),
mhd. guot,
asächs. aengl. gōd,
mnd. gōt,
engl. good,
mnl. goet,
nl. goed,
afries. god,
anord. gōðr,
schwed. dän. god,
got. gōþs (
germ. *gōda-) gehört ablautend zu der unter
Gatte (s. d.) dargestellten Wurzel
ie. *ghadh- ‘vereinigen, eng verbunden sein, zusammenpassen’ (vgl. auch
aind. gádhyaḥ ‘was man gerne festhält, was einem paßt’,
aslaw. godьnъ ‘gefällig, geeignet’ sowie
ahd. gigat ‘passend’). Als Ausgangsbedeutung von
germ. *gōda- wird danach etwa ‘passend, geeignet’ anzusetzen sein. Das Wort zeigt, teils schon in sehr früher Zeit, eine reiche Bedeutungsentwicklung, die, von ‘passend’ ausgehend, zunächst zu ‘für einen Zweck geeignet, tauglich, brauchbar’, in spezifischer Anwendung auf Personen ‘tüchtig, geschickt’ führt. Aus dem Begriff des Geeignetseins für einen bestimmten Zweck entwickelt sich
gut zum Wertbegriff im Sinne von ‘wertvoll, kostbar, hochwertig, qualitativ einwandfrei’ (bei Sachen), ‘vornehm, edel, angesehen, ehrlich’ (auf Personen oder deren Verhältnisse bezogen), ferner zum Ausdruck des Wohlgefallens, der Freude, die jemand an einer Sache oder einem Zustand hat, wird also zu ‘angenehm, bequem, vorteilhaft, erfreulich, fein, schön’. Aus ‘passend, geeignet’ entwickelt sich auch, gleichfalls schon in ältester Zeit, die Bedeutung ‘geneigt, wohlmeinend, freundlich, gefällig, gütig’; in allgemeiner ethischer Verwendung steht
gut im Sinne von ‘rechtschaffen, tugendhaft, anständig’.
gut wird auch zur Bezeichnung von Mengen- oder Maßangaben im Sinne von ‘richtig, ordentlich’ verwendet, woraus sich ‘reichlich, beträchtlich’ (
eine gute Stunde,
gute acht Tage) ergibt; schließlich kann
gut als Mittel der Steigerung etwa im Sinne von ‘tüchtig, gehörig, völlig’ (
ich habe gute Lust,
in gutem Einvernehmen) gebraucht werden. –
Gut n. ‘Besitz, Vermögen, versandfertige Ware, Ladung, Material, Stoff für einen bestimmten Arbeitsprozeß (Saat-, Steingut), größerer landwirtschaftlicher Betrieb’,
ahd. guot ‘Gutes, Vermögen, Besitz’ (8. Jh.),
mhd. guot, auch ‘Landgut’,
asächs. aengl. gōd,
anord. gott, Substantivierungen des Adjektivs.
Güte f. ‘hilfreiche, großherzige Gesinnung, Nachsicht, Freundlichkeit, gute Beschaffenheit, Qualität (einer Ware)’,
ahd. guotī (9. Jh.),
mhd. güete,
asächs. gōdi.
vergüten Vb. ‘entschädigen, zurückerstatten, die Güte, Beschaffenheit verbessern’,
spätmhd. vergüeten ‘entschädigen, auf Zinsen anlegen’; dazu
Vergütung f. (18. Jh.).
begütert Adj. ‘mit Gütern, Reichtum ausgestattet, reich, wohlhabend’ (16. Jh.).
gütig Adj. ‘voller Güte, hilfreich und verzeihend’,
mhd. güetec.
begütigen Vb. ‘gut zureden, besänftigen, beschwichtigen’ (15. Jh.).
gütlich Adj. ‘in gutem Einvernehmen, ohne Streit, friedlich’,
ahd. guotlīh ‘gut, heilbringend, segensreich’ (8. Jh.),
mhd. guotlich,
güetlich ‘gut, gütig, freundlich’.
Gutachten n. ‘ausführlich begründete Stellungnahme eines Sachverständigen’ (Anfang 16. Jh.), substantivierte Zusammenrückung aus
etw. für gut achten.
Gutdünken n. ‘eigenes, persönliches Ermessen’,
spätmhd. guotdunken, Substantivbildung aus Verbindungen wie
eʒ dunket mich guot.
Guthaben n. ‘worauf man Anspruch hat, zur Verfügung stehendes (gespartes) Geld, geldliche Forderung an jmdn.’ (um 1800), Substantivierung aus
etw. gut haben (heute
guthaben) ‘etw. zu fordern haben’. –
gutheißen Vb. ‘für gut befinden, billigen’ (16. Jh.), Zusammenrückung aus
etw. gut heißen.
gutmütig Adj. ‘von guter Gemütsart, nicht streitsüchtig, leicht zu beeindrucken, mitleidig’ (15. Jh.).
Gutschein m. ‘Schein über ein Guthaben in Waren oder Geld’ (19. Jh.), Verdeutschung für
Bon (s. d.).
gutwillig Adj. ‘guten Willen zeigend, gefügig’,
ahd. guotwillīg (um 1000),
mhd. guotwillic.
böse, …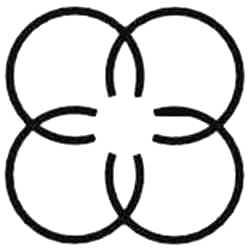
böse Adj. ‘schlecht, schlimm, schädlich’,
ahd. bōsi (10. Jh.),
mhd. bōse,
bœse ‘übel, gering, nichtig, wertlos, schwach’,
asächs. bōsi,
mnd. bȫs(e),
mnl. nl. boos,
afries. (in Zusammensetzungen)
bās-. Entsprechungen in den übrigen germ. Sprachen fehlen, so daß eine sichere Herleitung erschwert wird. Als lautlich verwandt kann
engl. to boast ‘prahlen’,
norw. baus ‘heftig, stolz, übermütig’ (wenn ursprünglich ‘aufgeblasen’) angesehen werden;
böse würde sich dann einer s-Erweiterung (wie auch
Busen,
pusten, s. d.) der Wurzel
ie. *b(e)u-,
*bh(e)u-,
*b(h)ū- ‘aufblasen, schwellen’ (wozu auch
Beule,
Beutel, s. d.) anschließen. Eine solche Verbindung ist aber bei der dabei vorauszusetzenden Bedeutungsentwicklung von ‘aufgeblasen’ zu ‘gering, wertlos’ wenig befriedigend. –
erbosen Vb. ‘erzürnen’,
mhd. erbōsen ‘schlechter werden’; vgl.
mhd. bōsen,
bœsen‘schlecht werden, Böses tun’.
boshaft Adj. ‘hinterlistig, schlecht’ (16. Jh.), älter
boshaftig (15. Jh.).
Bosheit f. ‘Hinterlist, Schlechtigkeit’,
ahd. (9. Jh.),
mhd. bōsheit ‘Wertlosigkeit, Nichtigkeit, Schlechtigkeit’.
schlecht, … 
schlecht Adj. ‘von minderwertiger Qualität, ungenügend, nicht gut’,
ahd. sleht (8. Jh.),
mhd. sleht ‘in gerader Fläche oder Linie, eben, glatt, leer, einfältig, gut, schlicht, einfach’,
asächs. sliht ‘geschmückt’,
mnd. slecht,
slicht,
mnl. sleht ‘eben, flach, gerade, richtig, einfältig, arglos’,
nl. slecht,
afries. sliucht,
mengl. engl. (aus dem
Anord.)
slight ‘schmächtig, schwach, leicht, gering’,
anord. slēttr ‘eben, glatt, sanft’,
schwed. slät,
got. slaíhts ‘schlicht’ (
germ. *slihta-), nach Art der Part. Prät. mit dem Suffix
ie. -to- gebildet zu der unter
schleichen (s. d.) angegebenen Wurzelerweiterung
ie. *(s)leiĝ- ‘schleimig, gleiten, glätten’ der auch anlautendes s- aufweisenden Wurzel
ie. *lei- ‘schleimig, durch Nässe glitschiger Boden, ausgleiten, worüber hinschleifen oder -streichen’ (s.
Leim,
Lehm), so daß eine Ausgangsbedeutung ‘geglättet, eben’ angesetzt werden kann. Seit dem 15. Jh. gerät
schlecht ‘einfach’ in Gegensatz zu ‘kostbar, wertvoll, ausgezeichnet’ und entwickelt die Bedeutung ‘geringwertig, nicht gut’, während die alte Verwendungsweise auf
schlicht (s. d.) übergeht. Reste ursprünglicher Bedeutung haben sich erhalten in der Formel
schlecht und recht ‘einfach und richtig’ und in den Komposita
schlechthin Adv. ‘ganz und gar, überhaupt, durchaus’ (17. Jh.);
schlechtweg Adv. ‘ohne weiteres, einfach’ (Ende 17. Jh.),
mhd. slechtis weg (14. Jh.);
schlechterdings Adv. ‘durchaus, ganz und gar, geradezu’ (Ende 17. Jh.), mit adverbialem -s nach dem älteren Genitiv Plur.
schlechter Dinge (1. Hälfte 17. Jh.). –
Schlechtigkeit f. ‘Zustand des Schlechtseins, Bosheit’ (18. Jh.); vgl.
spätmhd. slehtecheit ‘Glätte, Ebene, Geradheit, Aufrichtigkeit, Geringheit’.
schal
schal Adj. ‘fade’ im Geschmack, ‘abgestanden’ von Getränken (16. Jh.), übertragen ‘gehaltlos, geistlos, reizlos’ (17. Jh.). Mnd. schal ‘ohne Geschmack, trübe (von den Augen)’ (nd. auch ‘trocken, dürr’) gelangt im 14. Jh. ins Md. und im 16. Jh. mit der oben genannten Bedeutung in die allgemeine Literatursprache. Das Adjektiv ist verwandt mit schwed. skäll ‘mager, dünn, fade, säuerlich’, aengl. sceald ‘seicht, flach’ (in Ortsbezeichnungen), wozu engl. shallow, shoal ‘seicht, flach’, außergerm. mit griech. skéllesthai (σκέλλεσθαι) ‘aus-, vertrocknen, verdorren’ (s. Skelett) und (ohne s-Anlaut) lett. kalst ‘trocken werden’, so daß Anschluß an die Wurzel ie. *(s)kel- ‘austrocknen, dörren’ möglich ist (wozu auch die unter behelligen, s. d., aufgeführten Wortformen gehören). 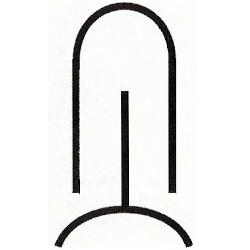
DA UNS UNSERE SPRACHE, das Wortgewebe im Raumströmen SO TREU alles sagt…. brauchen wir eigentlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, WIE HEILIG unsere Sprachen entstanden sind AUS DEM ERLEBEN VON MENSCHENWESEN,
uns da keinen „kunstvollen“ 2fehl’n… anheimgeben.
SPRACHE IST OFFENBAR JETZTWAHR.
Läppischr Dasbeweis? Wie die Leichenhäztlaffen mit ihren glosenden Ichichichnurdurchmichirnpfannen.. das beturnen und zerwüten, aus immer lächerlicheren „GrünstattdenMICHICHICHICHICHICH!!!!“-keuchereien. NICHTS darf sein, wie es natürlich ist! Sonst schnapp ich aus ab über raus egalwo rein… tja… die Guten und die Bösen: DER DeppenVEREIN-Hirnladlnschrank, das Egolurchversumpf… t rocken.
Wie verwirrt man Engel(Gegenwort: der Weitel, der Wahrel, der Tiefel)&Co.?
Dein Haß, dein Neid, deine Niedertracht, deine Gier.. bleibt bei dir.
Dein Wohlwollen, deine Schönheit segne ich, gegebenenfalls.. und nur ann, gebe ich sie auch gegen, be-gegne.
Awa das kommd ja von angelus!!??
Guuut, schauma uns DEN an:
Essere sovrumano, _______übermenschlich, also dem fehlt unsere Dimensionasdirchungskraft, und ob über- oder unter- ist in diesem Sinne einfach NICHT WAHR MIT.
ministro di Dio__________ D’io, gell.. das iss halt schwierig, denn wer da so aller, entweder sich oder das eigenen Überich und die eigene Gier als DIO erzählt, da hamma leider meghr Reifenplatzer als Räder, tja..
presso gli uomini __________ und „die Menschen“: lernen wir jka langsam auch daß diese = wir mehr sind, als ein sehr gut ausgestatterter Fleischwürstebetrieb. Tja…
per annunciare e fare eseguire la sua volontà. __________ tja, wie gesagt: das nützen immer nur Ungute, um uns einfahren zu lassen, und selbst schön miteinzufahren. Ende der Beobachtung <<.
Il termine greco ἄγγελος («messaggero») applicato a messi divini (Hermes, Iride, la Fama, talvolta in connessione con l’Oltretomba)
____________ tja.. Bote, Boten.. nur: wer schickt denn die wirklich?
venne usato dai traduttori greci dell’Antico Testamento
________oiso mia sann do bai di oittn Hiatnföka, gäööö; aus anderer Sicht, wo der gute Anunaki, der so gerne vögelte, sein Ganzargunwesen trieb (sein Bruder war angeblich etwas Mischlingswesen (angeblich erst Plejader, dann von den Dracos übernommen und weiterverzüchtlt, na und so ghalt.. eine bewegte Zerstörungsgeschichte, die sie dann erdeausgossen.. siehe Frau Ashaiana Deane, Frau Carry Cassidy, Frau Goguen.. und viele andere Autoren) per rendere l’ebraico mal’āk, che vale «messaggero, ministro».
________und hier sind wir somit in einem völlig hierarchisch hirnkriechenden Völklein gelandet… das sich vor alles nur kotaustaubbusselte… UND IHR NIEDRIGSEIN genossen, WAS das Sündigen so sinnvoll und schmackhaft macht, denn die Rechnung kommt solchen Blunzenshädeln IN IHREM „BETTELN“, das sie Beten nennen, ja erst NACH de Erdeleibtod. Daß DAS keine Moral oralisiert, iss uns klar.
Gli a., esseri superiori all’uomo (detti anche «figli» di Dio,
Genesi 6, 2;
Giobbe 1, 6),
formano gli eserciti di Yahweh, _____________und do samma scho in da Dauaraffarei! UND DAS WEIB, der der Mann der Pflug und das gesamte HIRNPFLÜCKMICH dieser impotenten, begegnungsunfähigen Weitwesen, die alle Feinungen zu zerstören sich als Hohetliche Lebensaufgabe geben, denn sie sind für alles ECHTNATURGESCHEHENSPRECHEN viel zu rozzi, plumpü, banal, schal.. einfach nur Riesig, wie die Riesenorgel im Stephansdom. DU-MM. dem Du die Hure hirnen.. da man das Du wahr, auch das Gottes, des geneigten Raumes.. einfach nicht das Wesensraumformat hat, zu erfassen UND BESTEHEN ZU LLASSEN:
weil ich ein Ekelbeutel bin, getrieben von, was sich dieses Schläuchvolk als UNS ZU GEBENDE 1ß Gebote-Totsünden erzählt…. DIE PREDIGEN IHNEN SELBST IN IHREM Libellumg Bibel!!! —–
MUSZ MEIN GOTT, ALSO MEINE EGOSOAUFBLASUNG, DASZ NICHTS DANEBEN MEHR PLATZ HAT….
DAUERND KEIFEN, ALLE VERURTEILEN, JEDEM DRÄUEN, ALLES beenden und anfangen – die TimeLineFreßWürschtln… und bliblablo wissma.
fanno conoscere e osservare i suoi voleri: __________tja, wenn geistlose Hirnhierarchien röcheln.. DANN IST DAS SOLCHER GOTTHEITEN VOLERE, Wille und Wollen und Wünschen.. jaja, awa klaaa.
varcano le distanze in un attimo, _____________ DA SIE KEINE Wesensräume leben, zippzappen sie logo supi…
appaiono agli uomini (talvolta in
sogno o in visione)
in forma umana, ________lästig Punkt!
proteggono uomini (come Raffaele, custode di Tobia) _________ naaa, daunkscheen!
e nazioni _________ GENAU SO SCHAUM AUS!!!
o li puniscono.________ DER Spieß ist weidlich umzudreh’n, und zwar RAUMSCHWINGUNGS.. statt sich in Raum filzungs…
GEGEN ALLES DIESES GESÖTTE.. GESPANNTER DUFT, gespannte Luft, RAUM IN ALLEN REGELN SCHLAGEND MACHEN, wie wir ihn ganz natürlich laufend tragen, und damit ALLEN DIESEN WAHRSTRUKTUREN ALS unsere Regeln gehorchen immer auch! EINMAL EINFACH DENEN TOTAL HIN- UND HINEINKIPPEN, was wir laufend leisten, indem wir einfach sind.. in dieser Dichte auch.. und nicht in allen anderen mit, und dann lauter Bimpfwesen als Aufzüge überallhin dienen, immer zu unserem VerdERB!
Wie verwirrt man Engel&Co.?
Indem man ihnen die (eigene) Wahrheit sagt (raumschwingt)_ Deine Welt wird nicht die meine, dein T-Raum nicht mein Traum, und dein Gott wird meiner ebensowenig,
denn ganz anders ruhe ich in, und ruht in mir
Gott und ich,
letztlich.. mein Ich im Wir und das Wir unendlich stillgut in mir auch..
Billigversionen will ich nicht bääähurTEILen.. aber sie mögen bitte ihre Penetranz bremsen, sonst gibt’s VOLLRAUM! Und ob du aushältst, was wir Menschen natürlich tragen.. kannst du auf die Tour gerne ausprobieren.. ich bin Vollraum mit Allteilhabe. Wenn du das nicht bist, wird dich, dem unvermittelt ausgesetzt zu sein, da ich dich in mir nicht weiterenthalte, sondern feststelle — was mir in mir absolut erlaubt ist!!! /ich bin ja nicht die hatscherte ChemtrailBH&PolitickerAabwehr <<<<. ///—– wirst du TEIL= TEILNAHME IN MIR nicht nach deiner Schlief- sondern nach meiner Ganzwahl. Dann schauma, wie’st außßakriechsd <<<.
Man HAT Wesensraumgrenzen zu wahren!
Denn diese sind heiliges Werden, und nichts und niemand hat sich darein zu keilschlagen.
Wer das nicht achtet und beachtete daraus,
fäbngt sich allemal restlosen Raumspruch ein, wenn das Parasitierte entweder geht, oder zerfällt oder dich ausscheidet, aus seinen Gewebhüllen entläßt.
Und dann ist von Gnade keine Rede, denn du bist jeglicher unwert vollends geworden mithilfe deines eigenen Willens, den du als Unwille dahinzukadavern genoßst.. Mit Raum gibt es keine Rechnung, nur Folgerichtigkeit jedes Darinteils. Das kann dauern? Ja, es kann deine gesamte Mitausweitung anbelangen, wenn du dich insgesamt verdERBEn hast wollen.
Prosit! Nun bist du dir als Abschaum voll geglückt.
Das ist dann wohl, wenn Mordvergifthintergehstierlverzüchtfick++schackln ihre Glow Riae ähr-reichen.
Tja.. heimkommen ist immer schön.
Den Raum, den dein Handeln und Mithandeln entstehen hat lassen, nun auskosten. Erlöstwerden, infine, ihr selbst von euch.. Restln.
Sucht und Zucht… vielleicht nochmals kurz blättern:
Sucht, …
Sucht f. ‘krankhaft gesteigertes Verlangen, Bedürfnis, Gier’,
ahd. (8. Jh.),
mhd. asächs. suht ‘Krankheit’,
mnd. sucht,
mnl. sucht,
socht,
nl. zucht ‘Krankheit, starke Begierde’,
afries. sechte,
aengl. (aus dem
Asächs.)
suht,
anord. sōtt ‘Krankheit, Gram’,
dän. schwed. sot,
got. saúhts ist ein ti-Abstraktum (
germ. *suhti-) und schwundstufig zu einem in
got. siukan ‘krank sein’ belegten starken Verb gebildet, damit zu der unter
siech (s. d.) behandelten Wortgruppe gehörend. In seiner ursprünglichen Bedeutung ‘Krankheit’ (im Mittelalter auch prägnant ‘Pest, Aussatz, Fieber, Tobsucht’) tritt
Sucht seit dem 17. Jh. gegenüber Synonymen wie
Krankheit,
Siechtum,
Seuche (s. d.) stark zurück und ist in diesem Sinne im 19. Jh. als Simplex nahezu ungebräuchlich. Es bleibt geläufig in der Verbindung
fallende Sucht ‘Epilepsie’ (noch zu Beginn des 20. Jhs.) sowie in den Krankheitsnamen
Fallsucht,
Gelbsucht,
Schwindsucht, s. auch
Sehnsucht. Wohl unter dem semantischen Einfluß von (nicht verwandtem)
suchen (s. d.) entwickelt
Sucht die Bedeutung ‘intensives Verlangen nach etw.’, vgl.
Gefallsucht (18. Jh.),
Herrschsucht (18. Jh.),
Trinksucht (17. Jh.),
Trunksucht (19. Jh.), und gewinnt in der 1. Hälfte des 20. Jhs. Verbreitung als Bezeichnung für ‘krankhafte Abhängigkeit von Betäubungs- und Rauschgiftmitteln’. –
süchtig Adj. ‘von einem krankhaften Trieb erfüllt, gierig nach etw.’ (16. Jh.), ‘drogenabhängig’ (20. Jh.),
ahd. suhtīg (8. Jh.),
mhd. sühtec ‘krank’.
Zucht, …
Zucht f. ‘das Aufziehen, Züchten (von Tieren und Pflanzen) und dessen Ergebnis, (strenge) Erziehung, Gehorsamkeit, Disziplin’,
ahd. zuht ‘Unterhalt, Nahrung, Erziehung, Belehrung, Sprößling, Geschlecht’ (8. Jh.),
mhd. zuht ‘das Ziehen, Zug, Richtung, Weg, Erziehung, Bildung, Strafe, feine Sitte und Lebensart, Ernährung, Unterhalt, Abstammung, das Aufgezogene’,
asächs. tuht,
mnd. tucht ‘Zug, Ziehen, Aufschub, Verzug, Frist, Erziehung, Bildung, das Aufgezogene’ (besonders vom Vieh),
mnl. tocht,
tucht ‘das Ziehen, Erziehung, Nutznießung, Höflichkeit’,
nl. tocht,
aengl. tyht ‘Lauf, Bewegung, Unterweisung’,
anord. (wohl aus dem
Mnd.)
tykt ‘Zucht, Strafe’ sowie
got. ustaúhts ‘Vollendung, Erfüllung’ sind ablautende Abstrakta mit ti-Suffix (
germ. *tuhti-) zu dem unter
ziehen (s. d.) behandelten Verb. Sie bezeichnen zunächst ‘das Ziehen’ als Beihilfe bei der Geburt von Haustieren, danach die Ernährung und Pflege der Jungtiere sowie das Aufziehen von Pflanzen und (jungen) Menschen und (im menschlichen Bereich) Erziehung und Bildung.
Mhd. zuht gehört im Sinne von ‘feine Sitte und höfische Lebensart’ zu den Kernbegriffen der mittelalterlich-höfischen Ethik. –
züchten Vb. ‘planmäßig und auswählend Pflanzen oder Tiere heranziehen’,
ahd. zuhten (8. Jh.),
mhd. zühten ‘nähren, aufziehen’.
Züchter m. ‘wer planmäßig, auswählend, veredelnd Tiere und Pflanzen heranzieht’ (wohl erst 19. Jh.), zuvor
frühnhd. ‘Lehrer, Erzieher’; vgl.
ahd. zuhtāri ‘Ernährer, Erzieher’ (9. Jh.;
zuhtāra f. ‘Ernährerin’, auch ‘Nachkommenschaft’, 8. Jh.),
mhd. zühter ‘Vogeljunges’, auch ‘wer junge Tiere aufzieht’.
züchtig Adj. ‘brav, anständig’,
ahd. zuhtīg ‘geschult, maßvoll, zur Zucht fähig’ (10. Jh.),
mhd. zühtec,
zühtic ‘züchtigend, wohlgezogen, artig, höflich, gedeihlich, fruchtbringend’.
Gezücht n. ‘Heran-, Aufgezogenes’, oft geringschätzig ‘Brut, Gesindel, Geschmeiß’,
mhd. gezüchte; Kollektivum zu
Zucht. Vgl.
Otterngezüchte (
Luther, Mt. 3,7).
züchtigen Vb. ‘(körperlich) strafen’,
mhd. zühtegen,
zühtigen ‘durch Zucht erziehen, strafen, sich ziehen, bilden’; vgl.
ahd. afterzuhtīg ‘(nach dem Werfen der Lämmer) säugend’ und (zweifelhaft)
afterzuhtīgen ‘(nach dem Werfen der Lämmer) säugen’.
Unzucht f. ‘unsittliche Handlung’,
ahd. unzuht (10. Jh.),
mhd. unzuht ‘Ungehörigkeit, Ungesittetheit, Roheit, Gewalttätigkeit, Unsittlichkeit’.
unzüchtig Adj. ‘unsittlich’,
ahd. unzuhtīg (10. Jh.),
mhd. unzühtec,
unzühtic ‘zuchtlos, unsittlich’.
Zuchthaus n. ‘Strafanstalt’ (17. Jh.), ‘Wohngemeinschaft, Internat, Erziehungs-, Besserungsanstalt’ (16. Jh.).
Zuchtwahl f. s.
Selektion.
oh… Selektion
tja, da ist ja wohl einiges kosmosselektiert woann <<<.
Dann nochmals zurck in die Hirtenvolkersprachen:
Selektion, …
Selekta f. ‘Auswahl, Elite, Begabtenklasse (an Gelehrtenschulen)’, Entlehnung (17. Jh.) von gleichbed.
lat. (classis) sēlēcta, dem substantivierten Part. Prät. fem. von
lat. sēligere (
sēlēctum) ‘auslesen, auswählen’, aus
lat. legere ‘auf-, auslesen, sammeln, auswählen, (vor)lesen’ und
se- (s. d.).
Selektion f. ‘Auswahl’ (18. Jh.), danach ‘(natürliche) Auslese, Auswahl, Zuchtwahl’ (2. Hälfte 19. Jh.) in der Übernahme von
engl. (natural) selection (
Darwin, 1859), in
dt. Übersetzung
(natürliche) Züchtung (
Bronn, 1860),
(natürliche) Zuchtwahl (
Carus, 1871); aus
lat. sēlēctio (Genitiv
sēlēctiōnis) ‘das Auslesen, Auswahl’, Verbalabstraktum zu
lat. sēligere (s. oben). Der Ausdruck verbreitet sich mit
Darwins Theorie der stammesgeschichtlichen Entwicklung nach dem Prinzip der natürlichen Auslese (
Selektionstheorie, Anfang 20. Jh.). Davon abgeleitet
selektieren Vb. ‘für Zuchtzwecke auswählen, auslesen’, auch allgemein ‘aussuchen’ (19. Jh.); vgl.
engl. to select.
______
_______
irdisch, …
irden Adj. ‘aus gebrannter Erde, gebranntem Ton hergestellt’;
irdisch Adj. ‘zur Erde (als Planet) gehörig, auf der Erde befindlich’. Beide Adjektive sind Ableitungen von dem unter
Erde (s. d.) behandelten, mit Dentalsuffix gebildeten Substantiv.
Ahd. (11. Jh.),
mhd. irdīn,
erdīn ‘von, aus Erde, die Erde bewohnend, weltlich, sterblich’,
got. aírþeins, gebildet mit dem Suffix
germ. -īna- für Stoffadjektive (wie
golden,
eisern, s. d.), und
ahd. irdisc (8. Jh.),
mhd. irdisch,
erdisch ‘von, aus Erde, auf der Erde, weltlich, sterblich’ stehen lange Zeit synonym nebeneinander. Doch tritt schon früh in biblisch-kirchlichem Sprachgebrauch
irdisch überwiegend,
irden dagegen seltener im Sinne von ‘der Erde, der Welt, ihrem Leben zugehörig, dem Dasein auf der Erde verhaftet’ auf (als Gegenwort zu
himmlisch), so daß (etwa im 18. Jh.) eine semantische Trennung beider Adjektive im oben genannten Sinne üblich wird. –
überirdisch Adj. ‘über der Erde befindlich, übernatürlich, himmlisch, göttlich’ (17. Jh.).
unterirdisch Adj. ‘unter der Erde befindlich, höllisch, teuflisch’ (17. Jh.).
Erde, …
Erde f. ‘fruchtbarer Boden, Land, die irdische Welt, unser Himmelskörper’,
ahd. erda (8. Jh.),
mhd. erde,
asächs. erða,
mnd. ērde,
mnl. aerde,
eerde,
nl. aarde,
afries. erthe,
irthe,
aengl. eorþe,
engl. earth,
anord. jǫrð,
schwed. dän. jord,
got. aírþa (
germ. *erþō), gebildet mit Dentalsuffix neben
ahd. ero (9. Jh.) und verwandtem
griech. éra (
ἔρα) ‘Erde’; Suffix mit Halbvokal zeigen
anord. jǫrfi ‘Sand, Sandhügel’ und
kymr. erw ‘Feld’. Allen gemeinsam ist die Wurzel
ie. *er- ‘Erde’. –
erden Vb. ‘eine elektrische Anlage zur Ableitung von Fehlspannungen mit der Erde verbinden’ (Anfang 20. Jh.).
beerdigen Vb. ‘begraben, bestatten’ (17. Jh.).
Erdapfel m. (17. Jh.), landschaftlich für
Kartoffel (s. d.), vgl.
nl. aardappel,
frz. pomme de terre; dagegen
ahd. erdaphul ‘Melone, Saubrot, Alkannawurzel’ (11. Jh.),
mhd. ertaphel ‘Frucht der Mandragora, Gurke’. Landschaftlich
Erdbirne f. längliche Kartoffel (17. Jh.).
Erdbeere f. ahd. erdberi ‘Erdbeere, Heidelbeere’ (9./10. Jh.),
mhd. ertber,
nl. aardbei,
aardbezie,
aengl. eorþberge.
Erdkreis m. ‘die bewohnte Erde, Erdball’, anfangs
Erdenkreis (1. Hälfte 16. Jh.), Übersetzung von
lat. orbis terrārum.
Erdkunde f. (18. Jh.),
dt. Ausdruck für
Geographie (s. d.), älter
Erdbeschreibung (16. Jh.).
Erdnuß f. dünnschalige, bohnengroße Ölfrucht, deren Fruchtkapseln sich vor der Reife in die Erde senken (18. Jh.); vgl.
ahd. erd(h)nuʒ (9./10. Jh.),
frühnhd. ertnus,
aengl. eorþnutu für verschiedene Knollengewächse.
Erdöl n. in der Erde vorkommendes Kohlenwasserstoffgemisch, ‘Rohöl’, im 18. Jh. als
dt. Ausdruck für
Petroleum (s. d.); vorher auch
Bergöl,
Steinöl.
Erdreich n. ‘Erdboden, oberste lockere Erdschicht’;
ahd. erdrīhhi (um 800),
mhd. ert-,
erderīch(e),
asächs. erðrīki,
aengl. eorþrīce,
anord. jarðrīki gelten vor allem für die ‘Erde als Wohnstätte der Menschen’ im Gegensatz
(??) zu
Himmelreich.
Himmel, …
Himmel m. Die Herleitung der germ. Bezeichnung für das scheinbar die Erde überdeckende blaue Gewölbe ist nicht eindeutig gesichert. Neben ahd.himil (8. Jh.), mhd.himel, asächs.himil, mnd.hemmel, mnl.hēmel, nl.hemel, afries.himul, himel finden sich got.himins, anord.himinn, asächs.heƀan, mnd.hēven, aengl.heofon, engl.heaven, so daß sich germ.*hemila- und *hemina- gegenüberstehen. Sieht man in der n-Ableitung die ältere Form, so kann die l-Ableitung als Dissimilation gegen das inlautende m erklärt werden. Eher jedoch sind beide Formen als parallele Bildungen (vgl. de Vries Nl. 250) aufzufassen, die mit einer Bedeutung ‘das Bedeckende, Decke, Hülle’ mit der unter Hemd (s. d.) dargestellten Wortfamilie zu verbinden und auf die Wurzel ie.*k̑em- ‘bedecken, verhüllen’ zurückzuführen sind. Sehr zweifelhaft ist dagegen die Verwandtschaft mit Hammer (s. d.) und Anknüpfung an die Vorstellung von Himmel als ‘Steingewölbe’. – himmlisch Adj. ‘göttlich, herrlich, wunderbar’, ahd.himilisc (8. Jh.), mhd.himelisch. Himmelbett n. ‘Bett mit Baldachin’ (16. Jh.). Himmelfahrt f. entsprechend früher christlicher Vorstellung ‘die Auffahrt Christi in den Himmel’ nach der Auferstehung, ahd.himilfart (um 1000), mhd.himelvart. Himmelschlüssel n. hellgelber, zu den Primelgewächsen gehörender Frühjahrsblüher, ‘Schlüsselblume’ (nach der Ähnlichkeit der Blütenkrone mit einem Schlüssel), ahd.himilsluʒʒil (Hs. 12. Jh.), mhd.himelslüʒʒel; deminutiv Himmelschlüsselchen (16. Jh.).
Wir, die Allwohnenlassenden
weil wir es verstehen, uns um eigenen Dinge zu kümmern, und andere und anderer in Ruhe zu lassen. Das ist eine besonderes Art des Gewahrens, das Wahrgeschehenwünschen allen.
Nicht dieser depperte Friede als Mistaufen, von jedem Egohähnchen zu bestaksen, um seinen Gockelgottruf auszukehlen… /-gurgeln? … AUSZUHALSEN!
da Hois…
Schaut man sich an, wieviele Leben in absoluter Demut gelebt werden, werden all diese kraaradn Heen restlos unappetitlich, in der Tat!!
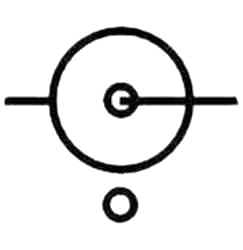
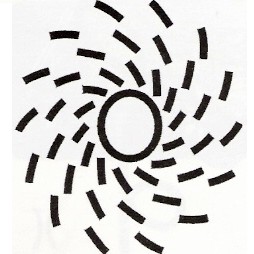
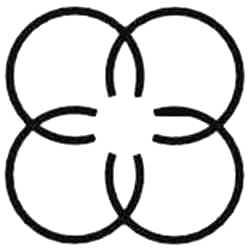


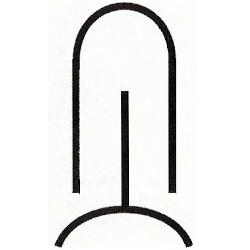
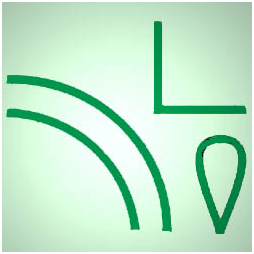

Kommentar hinterlassen